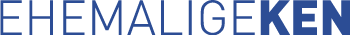Interview Nelio Biedermann

Sprachgrenzen ausloten
Nelio Biedermann (M22) hat mit Anfang 20 einen Roman geschrieben aus der Sicht eines 80-Jährigen. Ein Gespräch über den Drang, Spuren zu hinterlassen und die Frage, ob Literatur bleibt.
Text: Céline Schwarz (M20, celine.schwarz@ken-ve.ch)
Die naheliegendste Frage zuerst: Wie kommt man als junger Mensch auf die Idee, ein Buch aus der Perspektive eines alten Mannes zu schreiben?
Am Anfang stand für mich nicht das Alter im Mittelpunkt, sondern die Idee einer Figur, die unbedingt etwas hinterlassen möchte. So bin ich auf Anton gekommen – für ihn ist dieser Wunsch besonders dringlich. Tatsächlich gab es ihn schon vorher als Nebenfigur in einer kürzeren Geschichte, und ich habe ihn dann wieder aufgegriffen.
Anton beschreitet im Buch mehrere Karrierewege, die ihn ins Bleiben führen sollen. Als erstes versucht er sich am Romanschreiben und geht dabei sehr strukturiert vor. Er möchte Inspiration erzwingen, plant seinen Tagesablauf, erstellt eine Liste mit möglichen Themen und überlegt, weshalb er geeignet oder ungeeignet ist, über diese zu schreiben. Arbeitest du ähnlich?
Ganz und gar nicht so strukturiert. Wenn ich etwas abgeschlossen habe, fange ich oft viel Neues an und verwerfe auch vieles wieder. Am Ende bleibt dann irgendetwas, das Bestand hat. Aber die Frage, wie man ins Schreiben kommt, war auch meine Frage.
Gibt es Themen, über die du gerne schreiben würdest, dir es aber nicht zutraust?
Ja, auf jeden Fall. An meinem nächsten Buch habe ich sogar schon vor «Anton will bleiben» gearbeitet. Dazwischen habe ich bestimmt viermal aufgegeben, weil ich dachte, dass ich noch nicht gut genug bin. Es gibt auch Themen, über die ich nicht schreiben würde, weil mir das Wissen dazu fehlt. Wobei… streng genommen weiss ich ja auch nicht, wie es ist, ein 80-Jähriger zu sein. Trotzdem steckt viel von mir in Anton.
Nervt es dich, wenn Leute autobiografische Aspekte in deine Texte hineininterpretieren?
Bei diesem Roman stellte sich mir diese Frage weniger. Anders war das bei meiner Maturitätsarbeit, «Verwischte Welt», ein Roman über sechs Jugendliche. Viele Leute fragten mich, ob ich das wirklich alles selbst erlebt habe. Manche machten sich sogar Sorgen. Ich sehe das eher gelassen und finde es spannend, was die Leute alles in meine Texte hineinlesen – obwohl es ja in erster Linie fiktive Figuren sind. Ich ertappe mich selbst dabei, dass ich bei fremden Texten spekuliere, inwiefern sie mit dem Leben des Autors übereinstimmen. Ich denke, man muss damit rechnen, sonst sollte man vielleicht gar nichts veröffentlichen.
Was hat dich daran gereizt, über jemanden zu schreiben, der den Drang verspürt, etwas auf der Welt zu hinterlassen?
Vermutlich, weil ich dieses Bedürfnis bei mir selbst beobachtet habe und es hinterfragen wollte. Ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen ist ja im Grunde genau das – etwas festhalten, etwas hinterlassen. Woher kommt das?
Hat dein Roman eine Botschaft?
Anton gibt diesen Drang am Ende auf und akzeptiert, dass er keine bleibende Spur als Berühmtheit hinterlassen wird. Das erscheint mir eine vernünftige Erkenntnis. Ob ich sie selbst verinnerlicht habe? Mehr als früher, aber vielleicht noch nicht ganz.
Anton leidet beim Romanschreiben überwiegend. Wie ist das bei dir – erlebst du das Schreiben manchmal auch als mühsamen Prozess?
Der Anfang ist immer lustvoll. In der Mitte wird es dann zäh – mit grossen Zweifeln an allem: am Text, an mir selbst … Aber ich mache einfach weiter, und am Ende wird es meistens wieder versöhnlich.
Wie viel Plan steckt hinter deinen Geschichten?
Bei «Anton will bleiben» hatte ich zuerst das Ende im Kopf, und irgendwann den ersten Satz. Dazwischen aber fast nichts. Auch sonst habe ich kein festes Konzept. Die Figuren tauchen auf, wenn sie mir in den Sinn kommen, und formen sich erst während des Schreibens. Mir fällt es schwer, eine Geschichte weiterzudenken, wenn ich nicht gerade am Schreiben bin.
Welche Rolle spielt Katharina in deinem Buch?
Mir war es wichtig, Anton jemanden entgegenzusetzen und verschiedene Perspektiven einzuführen. Anton hat anfangs einen sehr starren Blick auf das Leben, Katharina ist in vielen Bereichen sein Gegenteil.
Hast du Rituale, die dir helfen, konzentriert und kreativ zu bleiben?
Spaziergänge helfen mir – da bin ich Anton ähnlich. Wenn ich keine Ideen habe, hilft es mir auch, andere Bücher zu lesen oder Filme zu schauen. Oft entstehen dabei zumindest Szenen oder Bilder, auf die ich später zurückgreifen und sie irgendwo einbauen kann.
Gibt es Momente, in denen das Lesen dein eigenes Schreiben eher behindert als fördert?
Andere Autor*innen haben mir erzählt, dass sie während des Schreibens nicht lesen können – das fände ich schade, weil ich immer an etwas schreibe. Dann könnte ich ja nie lesen. Allerdings lese ich gerne in eine bestimmte Richtung. Mein nächster Roman erstreckt sich über mehrere Generationen in Ungarn, also habe ich bewusst Bücher gewählt, die entweder in dieser Zeit spielen oder sich mit Familiengeschichten befassen. Dabei muss ich natürlich aufpassen, dass, falls ich einen bestimmten Stil aufgreife, dies ganz bewusst tue.
Gibt es einen Autor und ein Buch, die dir besonders wichtig sind?
Mein Lieblingsschriftsteller ist Christian Kracht. Ein einzelnes Buch herauszupicken, fällt mir schwer – «L’Étranger» von Albert Camus gehört aber definitiv dazu.
Gibt es Motive, zu denen du beim Lesen oder Schreiben immer wieder zurückkehrst?
Das Thema Vergänglichkeit begleitet mich.
Erinnerst du dich an den Moment, der dich zum Schreiben gebracht hat?
Sogar genau, das war der Schreibwettbewerb an der KEN, bei dem ich eher zufällig mitgemacht habe. Ich war in Quarantäne, hatte plötzlich viel Zeit und das Thema –«die Enden der Welt»– hat mich angesprochen. Dass ich gewann, war natürlich motivierend. Valeria Soriano, meine Deutschlehrerin, hat mich im Schreiben weiter bestärkt und später meine Maturitätsarbeit betreut.
Eine weitere Bestätigung war wohl, dass du einen Verlag für dein Buch gefunden hast. Wie hast du das erlebt?
Es ging überraschend schnell. Meine Maturitätsarbeit wurde vom Kanton ausgezeichnet, und ich dachte, ich versuche es einfach und schicke den Text an ein paar Verlage, die ich kannte. Dann passierte erst mal ein halbes Jahr nichts – ich war auf Reisen und schrieb in der Zeit «Anton will bleiben». Als sich der Verlag dann doch noch meldete, schlug ich vor, dass sie stattdessen mein neues Manuskript lesen.
Denkst du, dass Lesen zunehmend an Bedeutung verliert? Beobachtest du das in deinem Umfeld?
Das Handy ist oft die bequemere Option – ich nehme mich da selbst nicht aus. Es fällt mir auch nicht immer leicht im Bus zu lesen, anstatt einfach nur aufs Display zu schauen. Aber ich habe den Eindruck, dass Bücher wieder wichtiger werden. Viele Menschen werden sich bewusster darüber, wie sie Social Media und ihre Handys nutzen. Früher war ich da pessimistischer.
Du studierst Germanistik und Filmwissenschaft. Wie unterscheiden sich diese Kunstformen?
Ein grosser Unterschied ist sicher, dass beim Film sehr viele Menschen beteiligt sind, und es schwierig ist, den gesamten Prozess zu überblicken. Entsprechend muss man Kompromisse eingehen: Wenn du Drehbuchautor bist, liegt die Umsetzung beim Regisseur. Selbst wenn du beides bist, stehst du vielen Geldgebern gegenüber. Beim Schreiben ist man unabhängiger.
Was mich am Film reizt, ist, dass er umfassender ist. Man lässt dem Publikum weniger Raum für eigene Interpretationen und kann viel mehr Ebenen einbeziehen – Bild, Musik, Geräusche.
Welche Rolle spielen Klassiker für dich?
Ich habe schon immer gerne Klassiker gelesen – aber nur, wenn sie nicht älter als 100 Jahre waren. Durch das Studium muss ich mich auch mit deutlich älteren Texten auseinandersetzen und habe dabei gemerkt, dass ich vieles daraus auch für mein eigenes Schreiben mitnehmen kann.
Beim Film war die Veränderung noch extremer. Nachdem ich fürs Studium so viele Stummfilme schauen musste, weiss ich inzwischen schon Ton zu schätzen. (lacht)
Mein Horizont hat sich auf jeden Fall erweitert, und ich bin heute offener für Dinge, die mir früher fernlagen. Aber es bleibt auch anstrengend – mittelalterliche Texte lese ich immer noch nicht einfach zum Spass.
Was fasziniert dich an Sprache?
Es ist doch einfach verrückt, dass wir für so vieles Worte haben und damit Dinge ausdrücken können – und dass Sprache neben der Realität eine eigene Welt schafft. Gleichzeitig gibt es viele Grenzen. In «Anton will bleiben» kommt dieses Thema mehrfach vor, z.B. dass einem die Worte fehlen, wenn jemand stirbt. Ich finde es spannend, diese Grenzen auszuloten.
Beim Lesen alter Texte – gerade lese ich «Wilhelm Meisters Lehrjahre» von Goethe – fasziniert mich die Vorstellung, dass diese einmal modern waren. Und dass sie es in gewisser Weise immer noch sind. Die Themen bleiben, nur die Sprache verändert sich.
Was würdest du mit Sprache gerne selbst erreichen?
Ich bewundere Autoren wie Albert Camus oder Ernest Hemingway, die mit einfacher Sprache Tiefe schaffen. Das sieht leicht aus, ist aber unglaublich schwer.
Welche Unterschiede siehst du zwischen deutscher und fremdsprachiger Literatur?
Wenn ein englisches Buch ins Deutsche übersetzt wird, hat es gleich 200 Seiten mehr. (lacht) Die deutsche Sprache ist vielleicht umständlich, bietet aber auch viele Möglichkeiten, beispielsweise für eigene Wort- und Satzkonstruktionen.
Dein nächstes Buch wird in verschiedene Sprachen übersetzt. Wie fühlt sich das an? Hast du beim Lesen der Übersetzung noch das Gefühl, dein Geschriebenes vor dir zu haben?
Es fühlt sich eher an wie ein Wiedererkennen – fast so, als hätte jemand anderes etwas sehr Ähnliches geschrieben. Durch die Übersetzung entsteht eine gewisse Distanz zu meinem Text, die es mir ermöglicht, ihn weniger kritisch zu lesen und dadurch mehr zu geniessen.
Wenn du dir aussuchen könntest, dass eine Person – tot oder lebendig – dein Buch liest, wer wäre es?
Mein nächstes Buch ist von meiner Familiengeschichte inspiriert. Deshalb würde ich mir wünschen, dass mein Grossvater es lesen könnte.
Welches Feedback hat dich bisher am meisten gefreut?
Dass Daniel Kehlmann mein Buch gelesen hat – das ist surreal! Seine Bücher stehen seit Jahren in meinem Regal.
Werden junge Autor*innen in der Literaturszene ernst genommen?
Ich habe oft das Gefühl, dass mein junges Alter mir als Vorteil dient – nach dem Motto: «Da ist noch viel Potenzial.» Mein Werk wird nicht isoliert betrachtet, sondern immer mit mir als Person zusammen. Aber das stört mich nicht. Ich würde es vermutlich genauso machen.
Wie gehst du mit Kritik um – sei es von Leser*innen, Verlagen oder Lektor*innen?
Absagen nehme ich mittlerweile ziemlich locker und sehe sie eher als Ansporn. Beim Lektorat kann ich Änderungen gut annehmen, aber auch für meine Version einstehen.
Nimmst du selbst während des Schreibprozesses viele Änderungen vor oder bleibt die erste Version weitgehend erhalten?
Letzteres. Ich schreibe immer zuerst von Hand, meistens abends, und tippe den Text am nächsten Morgen ab – das ist dann meine Überarbeitung. Danach fällt es mir schwer, nochmals grössere Änderungen vorzunehmen. Ist der Text einmal abgetippt, habe ich innerlich damit abgeschlossen.
Zur Person:
Nelio Biedermann ist 2003 geboren und am Zürichsee aufgewachsen. Bereits während seiner Zeit am Gymnasium wurden sein Roman «Verwischte Welt» und eine Kurzgeschichtensammlung vom Kanton Zürich ausgezeichnet. Er studiert Germanistik und Filmwissenschaft an der Universität Zürich. Sein nächster Roman erscheint im September 2025 bei «Rowohlt Berlin».